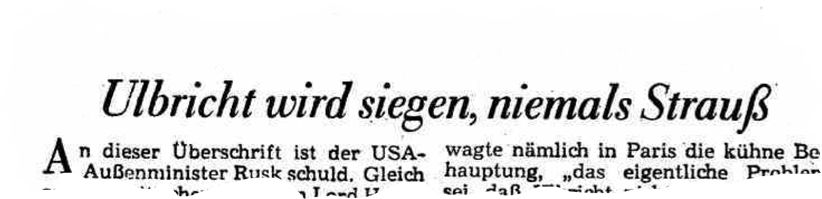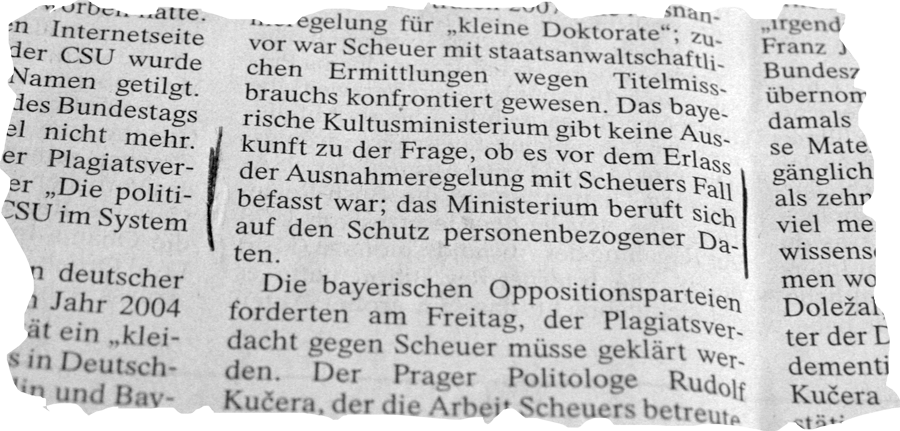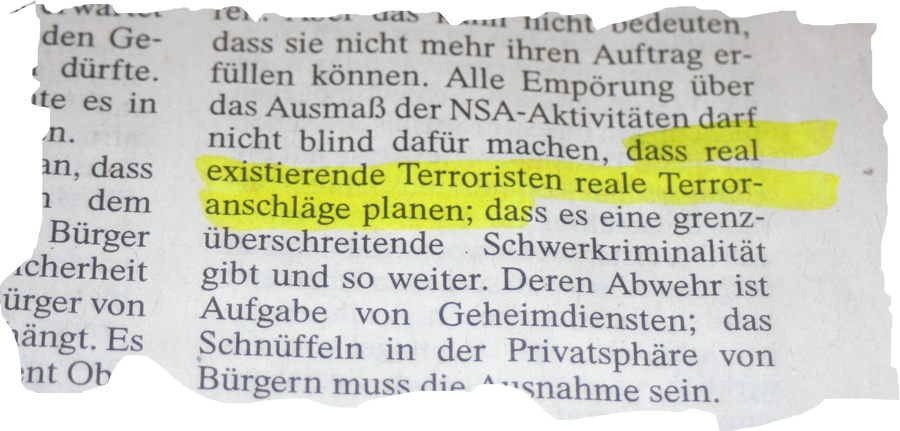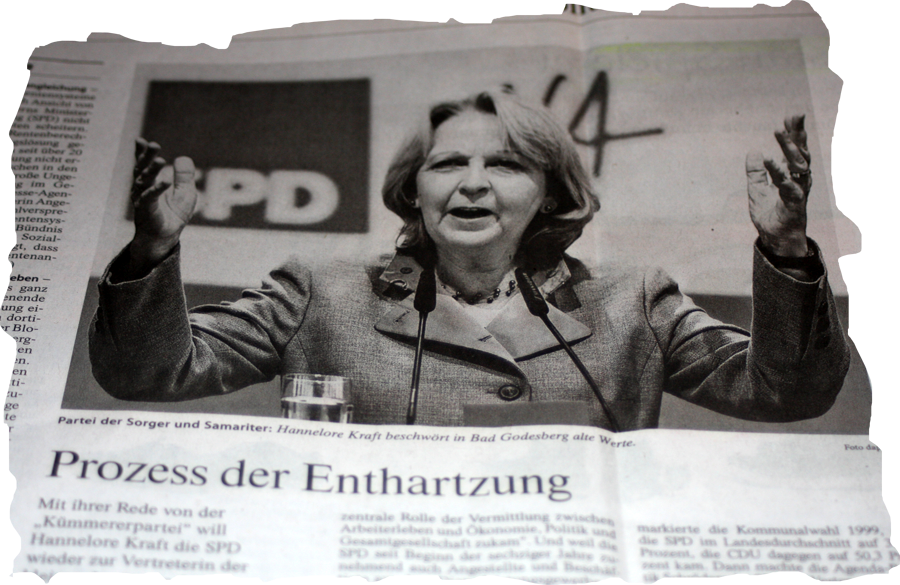Neusprech betrifft nicht nur den Wortschatz. Die Grammatik der politischen Sprache zeigt ebenso Auffälligkeiten. Und die sind oft gut versteckt. Einzelne, ungewöhnliche Begriffe mögen den gemeinen Wähler in Überschriften oder Ansprachen noch irritieren und seinen Argwohn wecken. Die wahren Künstler des Politikersprechs jedoch brauchen keine Neuschöpfungen und Umdeutungen, um ihre Absichten zu verschleiern. Sie nutzen ganz normale Wörter und bauen sie so geschickt zusammen, dass der Zuhörer gar nicht merkt, wie er verschaukelt wird. Anbei eine kleine Sammlung solcher Sprachkunststücke.
- Das Merkel-Wir: andere vereinnahmen oder aussperren
Kleine Wörter können eine große Wirkung haben. Zum Beispiel das Pronomen der ersten Person Plural. Die häufige Verwendung von wir ist geradezu typisch für die Sprache von Politikern. Das folgende Beispiel aus einer Rede von Angela Merkel auf einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in Osnabrück zeigt, warum:
„Heute hätten wir weder die libanesischen Kofferbomber gefunden, noch hätten wir die Schlägereien des alten Mannes in der U-Bahn in München so schnell aufklären können, und heute findet jeder Videoüberwachung auf großen Plätzen, öffentlichen Plätzen, ganz normal.“
Abgesehen davon, dass längst nicht jeder eine Videoüberwachung normal findet und solche Aufzeichnungen weder irgendeinem alten Mann halfen noch möglichen Opfern eines Attentats, kann davon ausgegangen werden, dass Angela Merkel die Kofferbomber nicht persönlich gestellt hat, und an der Aufklärung der „Schlägereien des alten Mannes“ überhaupt nicht beteiligt war. Das wir soll hier also eine Verbindung herstellen zwischen Merkel und ihrer Politik und den eigentlichen Ermittlern. Es wird somit extensiv verwendet. Merkel dehnt sich dadurch aus und macht sich die Erfolge anderer zu eigen. Für Politiker, die unter stetiger Beobachtung stehen und jederzeit die Wirksamkeit ihrer Handlungen beweisen müssen, ist das ein schnell erreichbarer und damit umso schönerer Effekt.
Doch das Pronomen kann noch mehr. Charakteristisch ist die Vermischung von ausschließdendem (exklusivem) und einschließendem (inklusivem) wir. So setzte Merkel ihre oben zitierten Ausführungen wie folgt fort:
„Wenn es die Union nicht gewesen wäre, […], hätten wir heute noch keine Videoüberwachung, und deshalb werden wir auch andere Themen auf die Tagesordnung bringen […]“
Das erste wir ist klar inklusiv, es schließt alle Hörer und überhaupt alle Deutschen mit ein, denn sie alle werden von Videokameras überwacht. Das zweite wir meint hingegen nur noch Merkel und ihre Partei, ist also exklusiv, da es alle Nichtmitglieder ausschließt. Diese ständige Vermischung von einschließendem und aussperrendem wir soll dazu führen, dass sich das Publikum mit der Partei und mit der Kanzlerin identifiziert, es soll die Bindung verstärken – ohne klar zu sagen, dass dort jemand eingebunden wird.
„Über-Ziercke, Merkel-wir und Guttenberg-Passiv: eine politische Grammatik“ weiterlesen