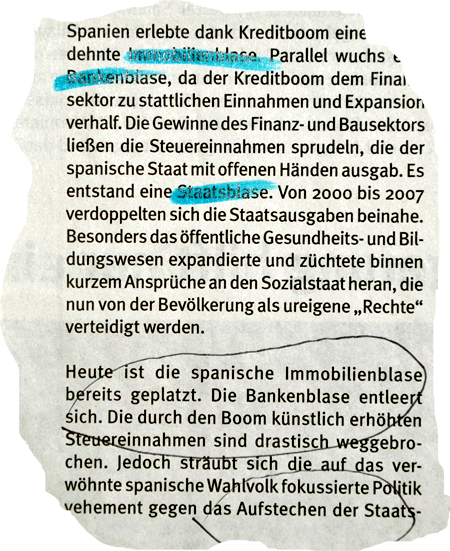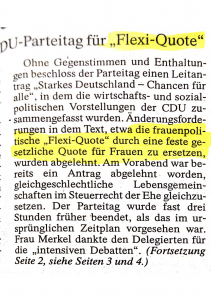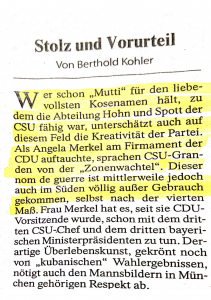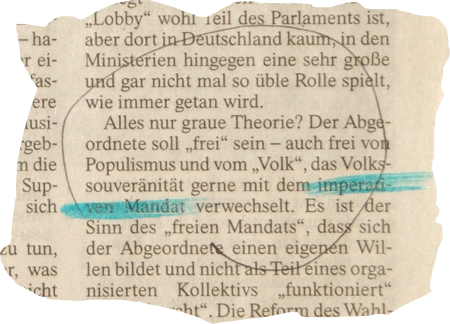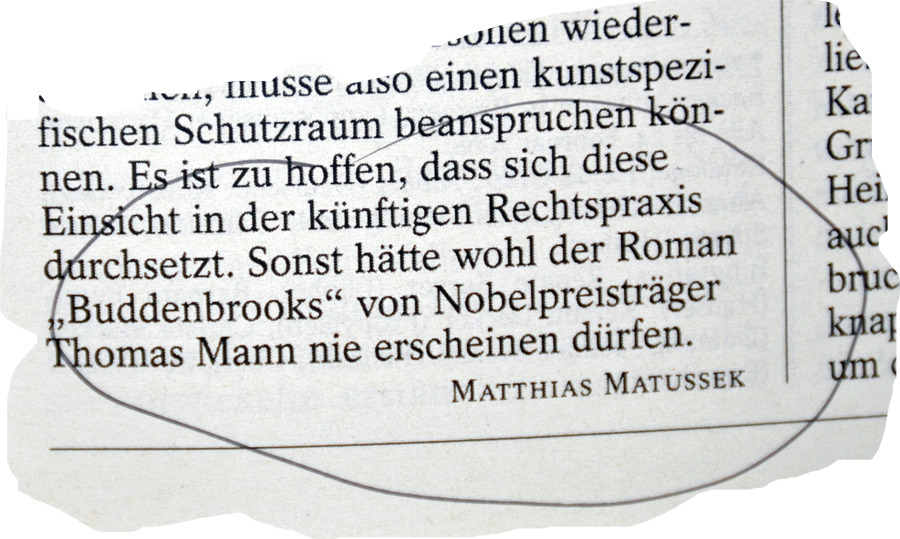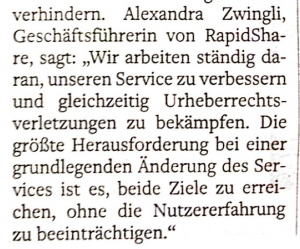Beispiel für eine sinnlose Steigerung über das plausible Maß hinaus, eine sogenannte Hyperbel. Kriminalität ist schon schlimm, niemand mag schließlich gern bestohlen oder betrogen werden. Politikern genügt jedoch die durchaus vorhandene Angst vor „normaler“ Kriminalität offensichtlich nicht, wenn sie Eingriffe in Freiheiten und Rechte der Bürger zu rechtfertigen versuchen. Selbst eine schwere Kriminalität reicht dafür anscheinend nicht mehr, es muss schon eine schwerste K. sein, um zu erklären, warum es unbedingt eine → Mindestdatenspeicherung braucht. Einerseits belegt das, wie dringend sich der Staat solche Überwachungsinstrumente wünscht. Andererseits zeigt es aber auch, wie unsinnig die ganze Forderung ist. Denn da die schwere Kriminalität, auch Verbrechen genannt, bereits Taten wie Mord, Vergewaltigung oder Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie umfasst, ist es schwer, sich eine schwerste K. überhaupt vorzustellen. Angesichts der Verfehlungen, bei denen diese Instrumente dann tatsächlich eingesetzt werden sollen, lässt sich nur noch konstatieren, dass bei dem einen oder anderen Politiker eine schwere Verschiebung des Rechtsbewusstseins stattgefunden haben muss. Anders ist nicht zu erklären, warum beispielsweise das Bundeskriminalamt wünscht, mit unseren ohne Verdacht gespeicherten Kommunikationsdaten, gemeinhin → Vorratsdatenspeicherung genannt, auch das illegale Herunterladen von Filmen und Musik zu verfolgen. Das zeigt, wie problematisch Hyperbeln sind und wie gefährlich es ist, seinen Wählern ständig Angst machen zu wollen, um ihnen härtere Gesetze zu verkaufen. Die normale und die schwere Kriminalität mussten schon so oft als Rechtfertigung herhalten, dass sie nicht mehr als Schreckensbild taugen. Was aber kommt nach der schwersten K., die überschwerste, die brutalstmögliche, die unvorstellbare? Wir werden es wohl leider bald erfahren.
Dieser Text erschien zuerst in unserem Buch „Sprachlügen: Unworte und Neusprech von ,Atomruine‘ bis ,zeitnah‘“