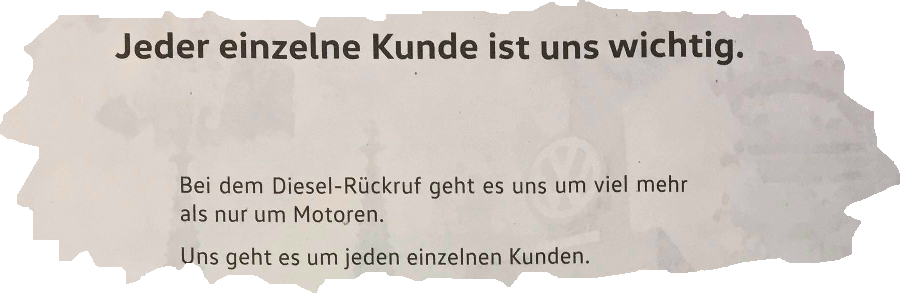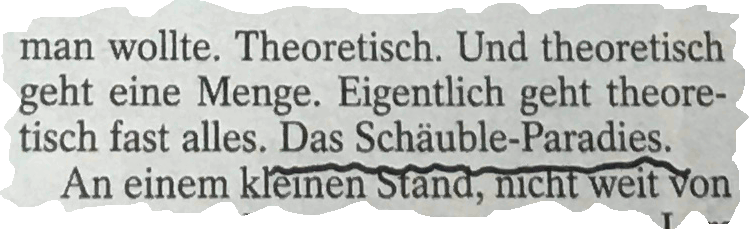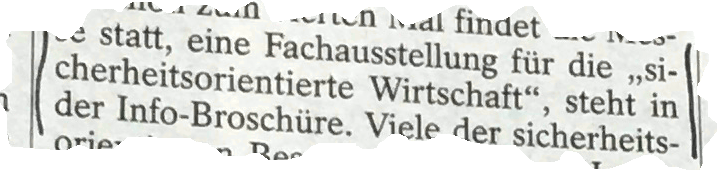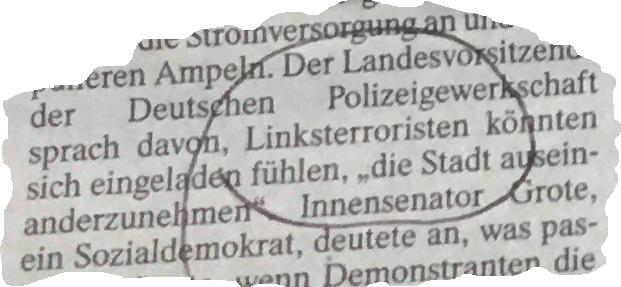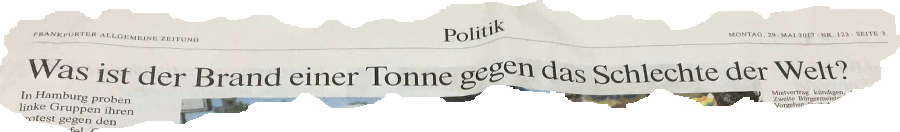Die bayerische CSU hat einen neuen Rechtsbegriff in ein Gesetz geschrieben, die → drohende G. Der Bayerische Landtag hat gerade ein „Gesetz zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen“ beschlossen. Das erlaubt der Polizei künftig, Wohnungen zu durchsuchen oder Menschen ins Gefängnis zu stecken, wenn die Polizei der Meinung ist, dass von diesen Menschen „in absehbarer Zeit“ Gewalttaten zu erwarten seien – von ihnen also irgendwann irgendeine G. droht. Das klingt gefährlich und so, als würde diese G. gleich über alle hereinbrechen. Aber dieser Eindruck ist falsch.
Rechtlich ist die → drohende G. viel ungefährlicher als die sogenannte konkrete G., die bislang in den entsprechenden Polizeigesetzen steht. Denn konkret bedeutet nach den Buchstaben des Gesetzes, dass es wirklich Hinweise darauf geben muss, dass gleich etwas passiert. Beispielsweise weil jemand in einem Ausbildungslager von Terroristen war und nun in Briefen an seine Freunde ankündigt, dass er am kommenden Donnerstag etwas in die Luft sprengen wird.
Eine → drohende G. ist sehr viel weniger bedrohlich. Das legt schon der alltägliche Umgang mit dem Begriff nahe. Den Menschen drohen mannigfache Gefahren, sobald sie aus dem Haus gehen. Und sogar im eigenen Bett droht ihnen noch eine ganze Menge, sogar der Tod. Was jedoch nichts darüber aussagt, ob dieser einen wirklich demnächst ereilen wird. Ähnlich ist es mit dem neuen bayerischen Polizeigesetz. Dem genügt es, wenn die “konkrete Wahrscheinlichkeit begründet ist, wonach in absehbarer Zeit Gewalttaten von erheblicher Intensität oder Auswirkung zu erwarten sind”. Somit wird aus der → konkreten G. nur noch eine „konkrete Wahrscheinlichkeit“. Was das ist? Das sagt das Gesetz nicht. Auch ob die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch gefährlich wird, 5 Prozent oder 95 Prozent betragen muss, ist nicht erwähnt. Womit das wohl nur der sprachliche Versuch ist, den schwammigen Begriff Wahrscheinlichkeit konkreter erscheinen zu lassen.
Doch damit entfernt sich die staatliche Gewalt immer weiter von Tätern und Taten und bewegt sich immer tiefer hinein in den Raum der Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Wer einmal Lotto oder Roulette gespielt hat weiß, wie tückisch dieser Raum ist und wie schnell man mit einer Beurteilung aufgrund von Annahmen daneben liegen kann. Jemanden ins Gefängnis zu bringen, nur weil man glaubt, dass er irgendwann etwas vorhaben könnte, ist staatliche Willkür. Noch dazu weil diese im Gesetz verniedlichend als Unterbindungsgewahrsam bezeichnete Haft praktisch unbegrenzt verlängert werden darf – ohne dass es zu einem ordentlichen Gerichtsverfahren kommt. Allein schon die verharmlosenden Wortwahl zeigt, dass hier willkürliche Staatsgewalt verschleiert werden soll. Nebenbei: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hielt den deutschen Unterbindungsgewahrsam 2011 unter bestimmten Bedingungen für eine Verletzung der Menschenrechte und forderte, der Staat müsse schon eine konkrete und spezifische Gefahr vorweisen können, um seine Bürger einsperren zu dürfen.
Der CSU-Politiker Florian Hermann sagte bei der Verabschiedung des neuen Gesetzes im Landtag: „Vorsicht ist besser als Nachsicht.“
Der Jurist Martin Heidebach von der Ludwigs-Maximilia-Universität München findet jedoch, dass das bayerische Gesetz gegen die Verfassung verstößt. Er schreibt, diese „Änderung der polizeilichen Generalklausel“ werde „zu einer massiven Verschiebung der Tektonik von Freiheit und Sicherheit führen – zulasten der Freiheit.“
„Das alles ist eigentlich unvorstellbar; bei diesem Gesetz ‘zur Überwachung gefährlicher Personen‘ denkt man an Guantanamo, Erdogan oder die Entrechtsstaatlichung in Polen. (…) Die CSU sollte sich schämen“, schreibt der Jurist und Journalist Heribert Prantl. Das Gesetz sei „eine Schande für einen Rechtsstaat“. Genau das gleiche schreibt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Sie war selbst Justizministerin. Zwei Mal.
Siehe auch → Gefährder und → Gefährder, potenzieller.