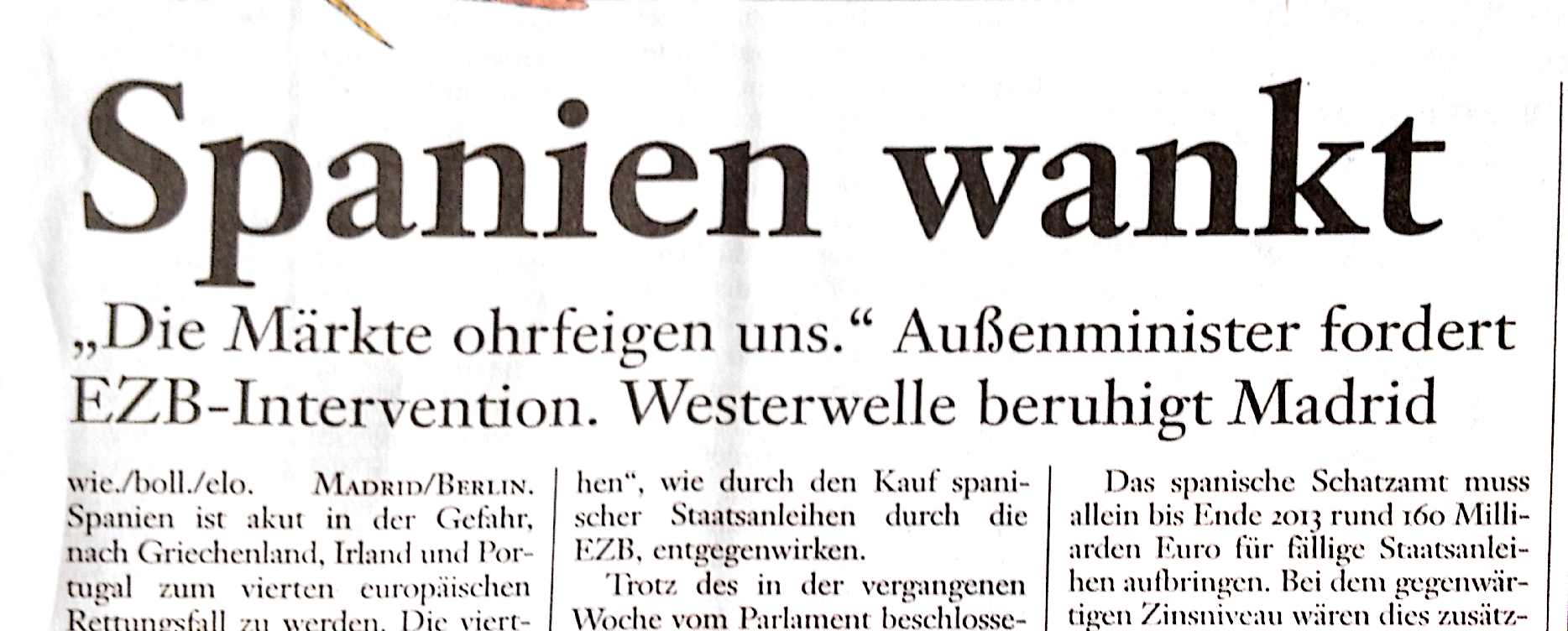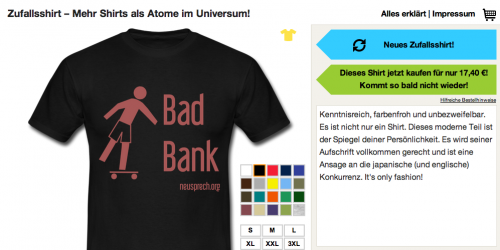Wir freuen uns, heute unseren zweiten Neusprechfunk anbieten zu können. Wir haben dabei unsere taz-Reflexe ausgelebt, wie immer neue Wortschöpfungen untersucht und dem Austriazismus gefrönt. Wir beschäftigen uns zudem mit staatlicher Bevormundung und Räuber Hotzenplotz weiteren ernsthaften Themen, bei denen sprachlich etwas im Verborgenen liegt.
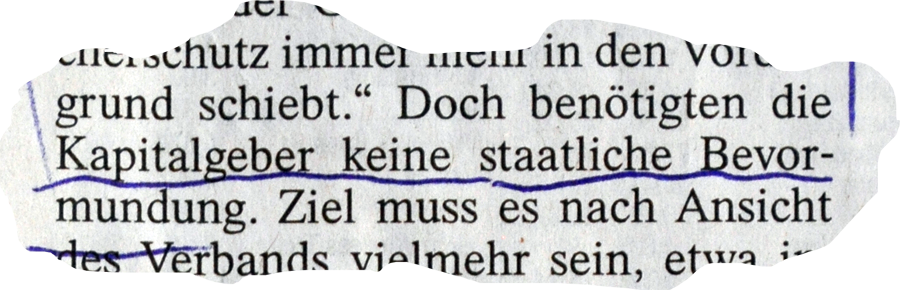
Erwähnung findet auch das Durchgoogeln sowie der Fickfaktor, der allerdings den Podcast erneut in die Erwachsenenkategorie einsortiert. Und Platitüden kommen natürlich auch nicht zu kurz.
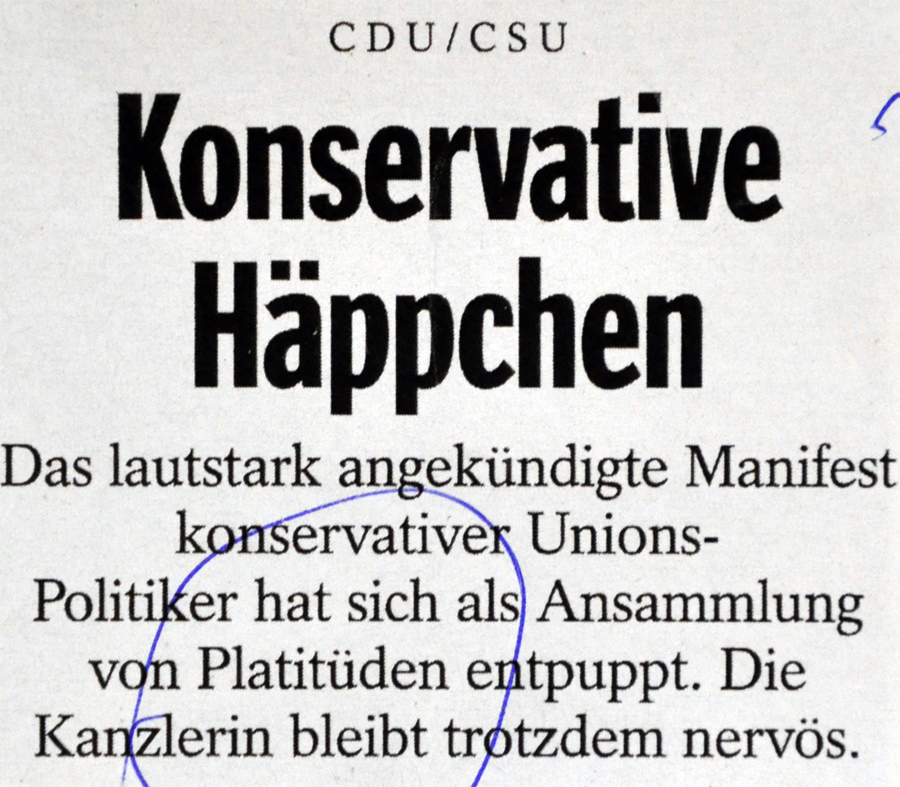
Wir sprachen über:
- “Konservative Häppchen”, Der SPIEGEL, Heft 37 vom 10. September 2007: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52909286.html.
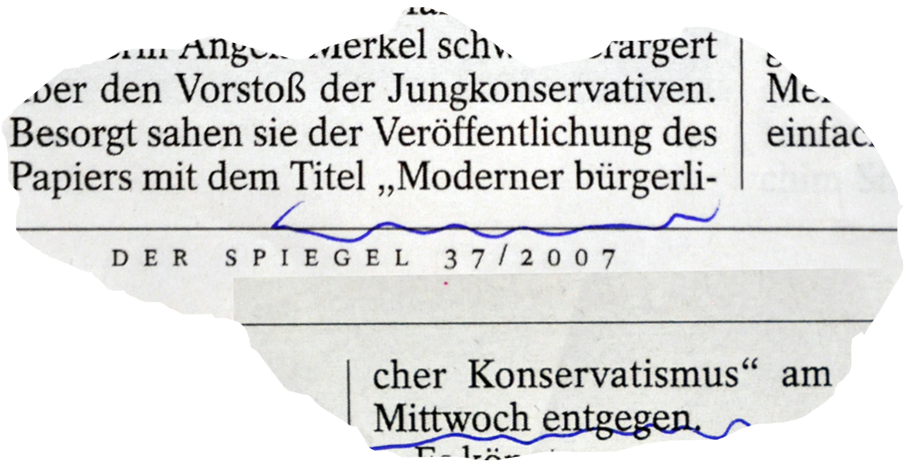
- DSW: Die Politik entmündigt die privaten Anleger, FAZ, Nr. 149 vom 29. Juni 2012, Seite 23.
- Die lesenswerte Analyse des ESM von Stefan Homburg in der FAZ vom 28. Juni 2012. Sein Urteil: „Während der Vertrag das Beschlussrecht des Parlaments bis zur Unkenntlichkeit verkrüppelt, eliminiert er das Kontrollrecht sogar vollständig: Die Mitglieder des ESM unterliegen einer unbegrenzten Geheimhaltungspflicht und Immunität (Artikel 34 und 35), die Räume und Archive sind unverletzlich, und alle Tätigkeiten des ESM sind jeder administrativen, gerichtlichen oder gesetzlichen Kontrolle entzogen (Artikel 32). (…) Im ESM-Vertrag ist ein zutiefst korruptes Begünstigungssystem angelegt.“
- Der Standard aus Österreich lässt Köpfe rollen und lässt sich sogar zu einem Handlungssubstantiv hinreißen, dem „Köpferollen“ …
- … und Spanien wankt, nachdem es von den Märkten geohrfeigt wurde.
Podcast: Play in new window | Download